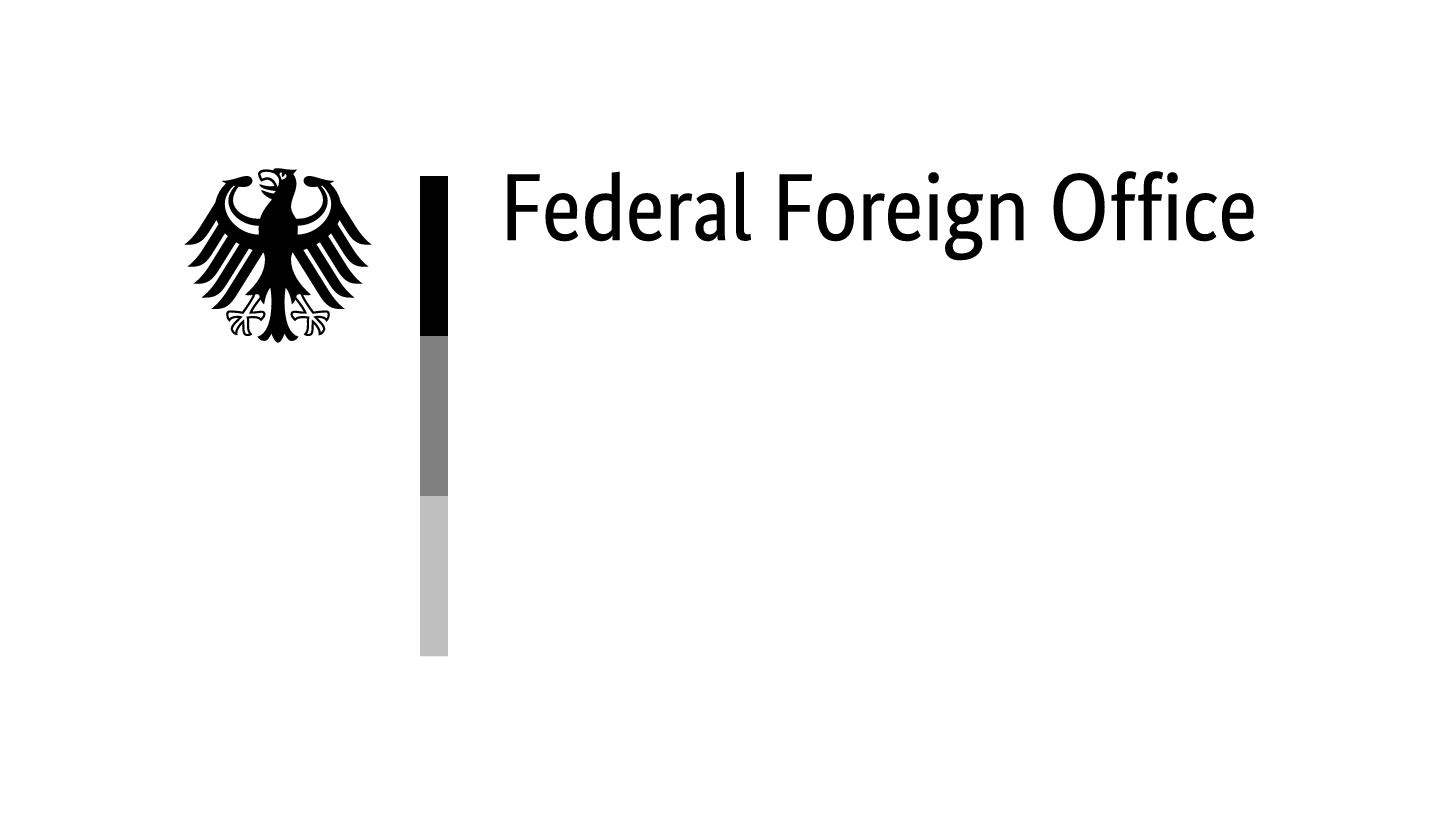Die ersten zivilgesellschaftlichen romani Organisationen in der Tschechoslowakei wurden Ende der 1960er-Jahre vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Liberalisierung des Landes gegründet. Es handelte sich dabei um die „Verbände der Zigeuner-Roma“, die in den tschechischen und slowakischen Bundesstaaten getrennt voneinander aktiv waren. Vorausgegangen waren wiederholte Versuche tschechischer und slowakischer romani Eliten, nach 1945 eine eigene Organisation zu gründen. Dies war jedoch von staatlichen Behörden abgelehnt worden, weil die Anerkennung einer kulturellen, ethnischen und sprachlichen Besonderheit einer Bevölkerungsgruppe, die offiziell als „soziale Gruppe“ bezeichnet wurde, nicht erwünscht war.
Die Verbände verfügten über Ortsverbände in der gesamten Tschechoslowakei und hatten zusammen mehrere tausend Mitglieder. Sie bemühten sich um die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Situation der romani Bevölkerung und engagierten sich auch in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Soziales. Zudem knüpften sie erfolgreich internationale Kontakte und nahmen etwa am ersten Welt-Roma-Kongress in der Nähe von London im April 1971 teil.
Slowakischer Verband
Der Slowakische Verband der Zigeuner-Roma [Zväz Cigánov-Rómov na Slovensku] wurde im November 1968 von staatlichen Behörden genehmigt, und im April 1969 fand in Bratislava die Gründungsversammlung statt. Zu den wichtigsten Gründer:innen gehörten Schlüsselfiguren der romani Emanzipationsbewegung der Nachkriegszeit, etwa Anton Facuna (1920–1980), ein ehemaliger Partisan, und Ján Cibuľa (1932–2013), Arzt sowie späterer Mitbegründer und Vorsitzender der International Romani Union.
Zu den wichtigen Funktionär:innen zählten Elena Lacková (1921–2003), Schriftstellerin und Dramatikerin, Gustáv Karika (1930–2016), Rechtsanwalt, Vincent Danihel (1946–2011), Rechtsanwalt und später Bevollmächtigter der Regierung der Slowakischen Republik für die romani Communitys, Rinaldo Oláh (1929–2006), Geiger und Komponist, sowie Dezider Banga (geb. 1939), Gymnasiallehrer und Schriftsteller.
Die Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs und der Völkermord wurden auf verschiedene Art und Weise thematisiert: in Reden der Mitglieder auf internen Veranstaltungen, in der internen Verbandszeitschrift Romen oder im Mitteilungsblatt Informačný spravodaj. In den Beitrittsformularen wurden Fragen zu Widerstandsaktivitäten während des Krieges gestellt, es gab Initiativen zur Förderung der Geschichte der Rom:nja (Schulbücher, Pläne für ein Museum) und seit 1970 wurde versucht, am Standort des früheren Arbeitslagers in Petič eine Gedenktafel anzubringen.
Die Hauptziele der Organisation waren gegenwartsorientiert und konzentrierten sich zum Beispiel auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in den romani Siedlungen. Der Verband wurde zunächst von dem Vorsitzenden Anton Facuna geleitet, auf ihn folgte Jozef Daniš (1914–unbekannt). Seit Oktober 1970 hatte der Verband eine kollektive Führung, mit Alojz Pompa (1943–1998?) und später Vincent Daniš (1934–unbekannt) als prägenden Persönlichkeiten.
Tschechischer Verband
Der Tschechische Verband der Zigeuner-Roma [Svaz Cikánů-Romů] wurde offiziell im August 1969 mit Sitz in Brno unter dem Vorsitzend von Miroslav Holomek (1925–1989) gegründet, einer Schlüsselfigur der Emanzipationsbemühungen der tschechischen Rom:nja. Eine Reihe von Expert:innen arbeitete eng mit dem Verband zusammen, zum Beispiel der romani Historiker Bartoloměj Daniel (1924–2001), der Historiker Ctibor Nečas (1933–2017) und die Sprachwissenschaftlerin Milena Hübschmannová (1933–2005). Eine wichtige Rolle spielte die Kommission der ehemaligen Opfer der Konzentrationslager, in der Mitglieder wie Anna Danielová (1921–1999), Rudolf Daniel (1911–1978) und Tomáš Holomek (1911–1988) aktiv waren.
Zentrales Ziel des Verbandes war es, den Prozess der Anerkennung der Rom:nja als Opfer des Nationalsozialismus voranzutreiben. Dieses Thema wurde auch in der internen Zeitschrift des Verbandes, Románo ľil, behandelt. Im März 1973 organisierte die Kommission die erste öffentliche Gedenkfeier auf dem Gelände des ehemaligen „Zigeunerlagers“ in Hodonín bei Kunštát. Pläne des Verbandes, dort sowie am Standort des ehemaligen Zwangslagers in Lety u Písku jeweils eine Gedenkstätte zu errichten, konnten vor der Auflösung des Verbandes im Jahr 1973 nicht mehr realisiert werden.
Zwangsauflösung 1973
Die Tätigkeit der Verbände war von Anfang an durch zahlreiche organisatorische und finanzielle Probleme belastet. Dies war teilweise das Ergebnis eines nach der Besetzung der Tschechoslowakei im August 1968 einsetzenden politischen Wandels, der seit Anfang der 1970er-Jahre zu stärkeren staatlichen Kontrollen führte. Das Regime war immer weniger geneigt, bürgerliche Initiativen zuzulassen, und die Einforderung von national umzusetzenden Maßnahmen für die Communitys durch die Verbände wurde als bedrohlich angesehen. Der offizielle Grund für die Auflösung der Verbände war jedoch schlechtes Management und eine angeblich geringe Mitgliederzahl.
Darüber hinaus hatten die Bezirksausschüsse des Slowakischen Verbandes Probleme mit ihrer Finanzierung, da sie die Mitgliedsbeiträge nicht effektiv einzogen und außerdem unterqualifizierten Arbeitnehmenden im Rahmen ihres Unternehmens „Buťiker“ – gegründet, um für Rom:nja Arbeitsplätze zu schaffen – hohe Löhne auszahlten.
Das Zentralkomitee des Slowakischen Verbandes wollte zudem der staatlichen Wohnungsbaupolitik etwas entgegensetzen, verfügte aber weder über die dafür notwendigen Befugnisse noch ausreichende finanzielle Mittel, um Eigentümer:innen von Häusern, die im Rahmen von Räumungsprogrammen abgerissen wurden, zu entschädigen, oder Darlehen für den Bau neuer Häuser zu vergeben.
Im April 1973 wurden die tschechischen und slowakischen Verbände der Zigeuner-Roma auf Druck staatlicher Behörden und aufgrund interner Kompetenz- und Machtstreitigkeiten sowie unterschiedlicher Auffassungen über die romani Kultur und Sprache zwischen staatlichen Stellen und den Verbänden aufgelöst. Ihre Aktivitäten und Ideen konnten erst nach 1989 wieder aufgegriffen werden.