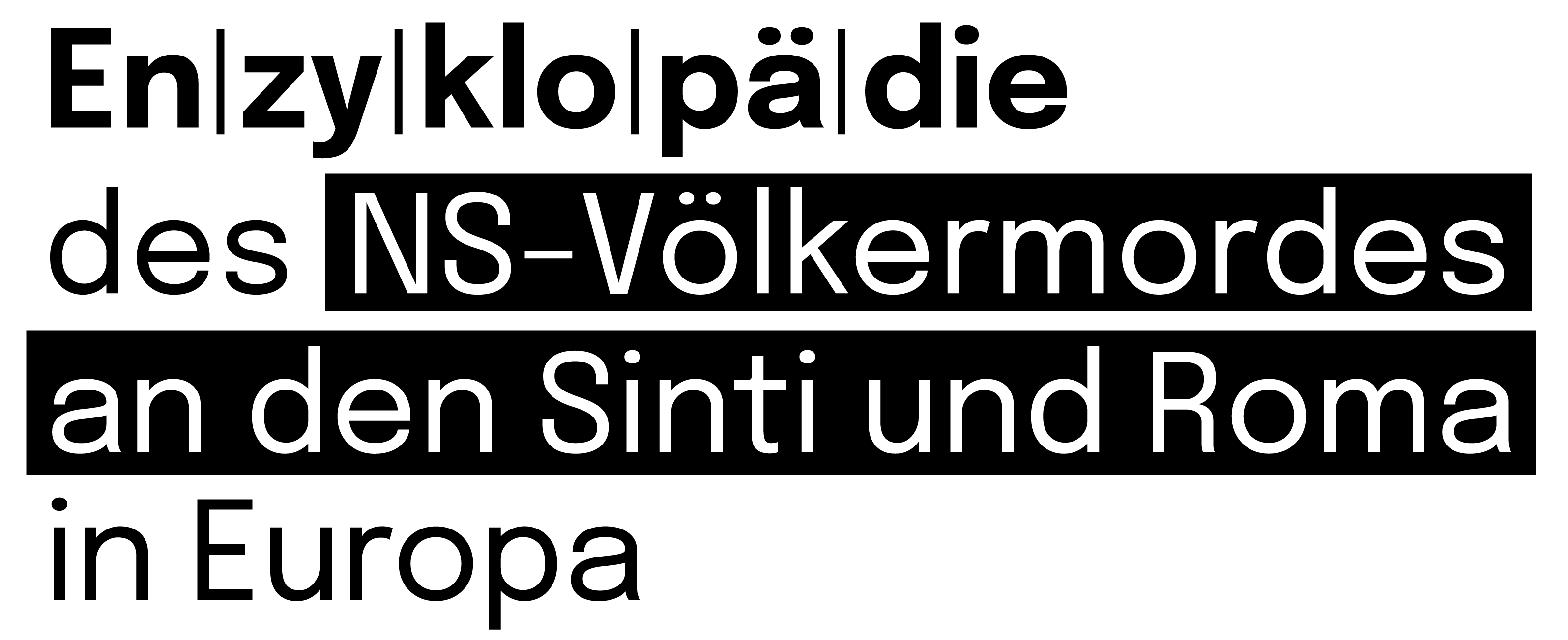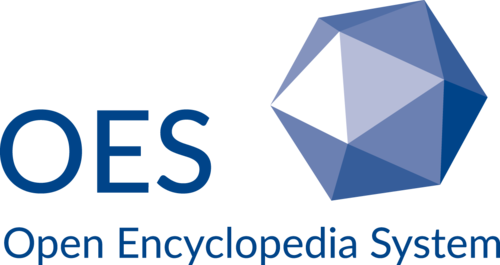Der Antiziganismus hat wie der Antisemitismus spezifische visuelle Codes hervorgebracht. Seit der Frühen Neuzeit formten sich Darstellungskonventionen aus, die „Zigeuner“ auf einer bildlichen Ebene definierten. Kern der visuellen Inszenierung ist die Zuschreibung einer fundamental anderen Lebensweise. Es handelt sich um einen festen Fundus von Motiven, Figuren, Handlungen und Szenerien; oftmals treten sie kombiniert auf. Als immer wieder reproduzierte Erkennungszeichen dienen sie bis heute dem reflexhaften Identifizieren der als fremd markierten Gruppe. Diese meist abwertenden, teils auch romantisierenden Markierungsmuster haben über Jahrhunderte Eingang in unterschiedliche visuelle Vermittlungsformen gefunden: von Malerei und Grafik bis zu Fotografie und Film.
Dieser Text behandelt die Rolle der Fotografie bei der Verfolgung der Sinti:ze und Rom:nja durch das nationalsozialistische Deutschland.
Fotografie und NS-Propaganda
Der zentral gelenkte Propagandaapparat machte sich die etablierten antiziganistischen Bildstereotype für seine ideologischen Ziele zunutze. Die visuelle Dehumanisierung sollte die Politik des systematischen gesellschaftliches Ausschlusses der Sinti:ze und Rom:nja legitimieren. Erklärtes Ziel war Desavouierung „romantischer“ Vorstellungen über „Zigeuner“ und deren Überschreibung durch das rassenbiologische Paradigma. Exemplarisch ist ein Beitrag mit dem programmatischen Titel „Verlogene Romantik“ in der SS-Zeitung „Das Schwarze Korps“ vom 15. Juli 1937. Text und Bilderzählung sind unmittelbar aufeinander bezogen: Die ebenso pejorative wie suggestive Fotostrecke diente als scheinbarer Beleg für die behauptete angeborene Kriminalität der Abgebildeten, die mit der Minderheit als Ganzes gleichgesetzt wurden. Die antiziganistische Vorurteilsproduktion fand auch Eingang in Lehrerzeitschriften und in Schulbücher, denen aus Sicht des NS-Regimes eine Schlüsselrolle in der „Rassenerziehung“ zukam.
Kriegsfotografie
Von besonderer Bedeutung für die nationalsozialistische Bildproduktion während des Zweiten Weltkrieges waren die sogenannten Propagandakompanien der Wehrmacht, die professionelle Fotografen in ihren Reihen hatten. Bis Kriegsende entstanden über vierzig Propagandakompanien, die neben den Filmaufnahmen für die nationalsozialistische „Deutsche Wochenschau“ – die wöchentlich Filmberichte in den Kinos zeigte – geschätzte zwei bis 3,5 Millionen Fotos und rund 80 000 Wortbeiträge produzierten. Zwar stand im besetzten Ost- und Südosteuropa das antijüdische Stereotyp im Vordergrund der Bildproduktion, doch gerieten ebenso die dort lebenden Rom:nja in den Fokus der Kamera. Der denunziatorischen Absicht entsprach die Wahl der Motive und die Art der fotografischen Inszenierung: „Der Ostjude“ und „der Zigeuner“ fungierten gleichermaßen als Verkörperung von „rassischer“ Fremdheit und Minderwertigkeit. Auch die Amateurfotos von Angehörigen der deutschen Wehrmacht, die sich als sogenannte Knipser betätigten, imitierten vielfach die von der offiziellen NS-Publizistik vorgegebenen Zerrbilder; zugleich wirkten in der privaten Bildtradition tradierte exotisch-romantische Vorstellungsmuster fort. Beiden Formaten ist ein radikales Machtgefälle eingeschrieben: Die Blick- und Deutungsmacht liegt ganz auf Seiten der Bildproduzenten. Ein weiteres Kennzeichen ist die scheinbare Abwesenheit von Gewalt. Der rassenideologische Vernichtungskrieg und das Tatgeschehen sind in den überlieferten Fotografien der Propagandakompanien wie auch in den Amateurfotos in aller Regel unsichtbar.
Fotografie und Rassenforschung
Neben dieser genuin propagandistischen Funktion spielte das Medium Fotografie auch im Kontext der Rassenforschung an Sinti:ze und Ro:mnja eine wichtige Rolle. Die 1936 in Berlin eingerichtete Rassenhygienische Forschungsstelle (RHF) verfolgte das Ziel, auf der Grundlage genealogischer und anthropologischer Untersuchungen eine Methode der „Rassendiagnostik“ zu entwickeln, um „Zigeuner“ zu identifizieren und zu klassifizieren. Wie die systematische Vermessung des Körpers, so war das Fotografieren integraler Bestandteil dieses großangelegten „rassenkundlichen“ Untersuchungsprozesses, der mit der totalen polizeilichen Erfassung der Sinti:ze und Rom:nja Hand in Hand ging. Die RHF erhielt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zwei Leica-Kameras samt Objektiven und beschäftigte eine eigene Fotografin. Überliefert sind Tausende Fotokarteien mit Porträts in Dreierserie, Negative, Farbdiapositive und Abzüge. Neben erkennungsdienstlichen Aufnahmen aus den Beständen der Kriminalpolizei machen anthropologische Aufnahmen des Gesichts, einzelner Körperteile oder seltener des ganzen Körpers einen Großteil des Bildbestandes aus, der heute im Bundesarchiv in Berlin überliefert ist. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufnahmen von Händen, Nasen und Augen (einschließlich Makroaufnahmen der Iris). Mit dem Farbdiafilm kam eine der neuesten Technologien zum Einsatz.
Die rassenanthropologische Fotografie war integraler Bestandteil eines Objektivierungs- und Abstraktionsprozesses, bei dem es nicht um das Individuum oder die Identifizierung einzelner Personen, sondern um die typologische Einordnung auf der Basis körperlicher Merkmale ging. Wenngleich sich eine „Rassendiagnose“ auf diesem Weg als undurchführbar erwies, verlieh das scheinbar wissenschaftliche Verfahren der staatlichen Vernichtungspolitik zusätzliche Legitimation. Neben erkennungsdienstlichen und rassenanthropologischen Aufnahmen beinhaltet der Bildbestand der RHF auch Fotografien, die im Zuge der Erfassung von Sinti:ze und Rom:nja an deren Wohnorten oder in kommunalen Zwangslagern entstanden und die einen dokumentarischen Charakter haben. Auf einigen dieser Bilder sind Robert Ritter (1901–1951), der Leiter der RHF, und seine Mitarbeiter:innen beim Befragen oder Vermessen von Sinti:ze und Rom:nja zu sehen. In ihrer Gesamtheit stehen die überlieferten Fotografien der RHF zugleich für die Beteiligung der (bio-)wissenschaftlichen Eliten am genozidalen Prozess.
Fotografien als historische Quellen
Welchen Erkenntniswert haben Fotoquellen, die in der Regel die Perspektive der Täter:innen wiedergeben, für die wissenschaftliche Aufarbeitung des Völkermords an den Sinti:ze und Rom:nja und für die Gedenkkultur? Die Aussagekraft solcher Fotos hängt wesentlich von der Kontextüberlieferung ab, also in aller Regel von ergänzenden schriftlichen Dokumenten, die eine Einbettung des Abgebildeten in einen größeren Zusammenhang ermöglichen. Dies zeigen etwa Fotografien von kommunalen Zwangslagern für Sinti:ze und Rom:nja: Es handelt sich um selektive Momentaufnahmen in propagandistischer Verzerrung. Die ideologischen und funktionalen Entstehungs- und Rahmenbedingungen dieser Lager müssen durch weitere Quellen erschlossen werden. Auch die erhalten gebliebenen Fotografien der Deportationen von Sinti:ze und Rom:nja in das Generalgouvernement im Mai 1940 und in das Konzentrations– und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im März 1943 erlauben trotz ihres hohen erinnerungskulturellen Symbolwerts nur begrenzte Aufschlüsse. Zwar zeigen sie neben den Opfern teils auch Täter:innen und Zuschauer:innen, die bürokratische Komplexität dieses hochgradig arbeitsteiligen Prozesses geben sie jedoch nur ansatzweise wieder.
Exekutionsfotos lassen sich nur in Ausnahmefällen Opfern der Sinti:ze oder Rom:nja zuordnen. Solche emotionalisierenden Aufnahmen gewähren einen wie es scheint direkten Blick auf den barbarischen Akt selbst. Doch gleichzeitig werfen die meisten dieser Fotografien aufgrund ihrer Vieldeutigkeit und perspektivischen Verengung Fragen auf, deren Antworten nur außerhalb des Bildes gefunden werden können. Die Bestimmung von Ort und Zeitpunkt, die Identifizierung der Opfer (oder, falls abgebildet, der Täter:innen), die Entschlüsselung der Tatumstände und die Rekonstruktion des Tatablaufs – all dies setzt eine erweiterte Quellenbasis voraus, die oft nicht vorhanden ist.
Neben diesen quellenkritischen Aspekten ist das kaum auflösbare ethische Dilemma zu nennen, mit dem uns die fotografischen Hinterlassenschaften der Täter:innen konfrontieren. Zwar bezeugen sie die Verbrechen des Regimes, machen diese buchstäblich einsichtig, zugleich reproduzieren sie jedoch die Stigmatisierung der Opfer oder zeigen diese in einem Zustand völliger Hilflosigkeit und Entwürdigung.
Die Verwendung von Täterfotos zum Zweck der historischen Aufklärung, sei es in Publikationen, Ausstellungen oder für pädagogische Zwecke, bedarf eines hohen Maßes an kuratorischer Verantwortung. Wie sich das Blickregime der Nationalsozialist:innen und die von ihnen systematisch betriebene Dehumanisierung politischer wie „rassischer“ Feinde wirksam dekonstruieren lassen, bleibt eine wissenschaftliche wie didaktische Herausforderung. Eine mögliche Strategie ist der Einsatz historischer Privat- und Familienfotos von Sinti und Roma: Sie eröffnen einen personalisierten Zugang zur Verfolgungsgeschichte und machen die vordem anonymen Opfer als Individuen mit vielfältigen Lebensentwürfen, eingebettet in lokale Lebenswelten, sichtbar. Als Gegen-Bilder können sie den entmenschlichenden Blick der Täter aufbrechen und das Bewusstsein für die visuellen Stigmatisierungsstrategien der Nationalsozialisten schärfen. Einrichtungen von Selbstorganisationen wie das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, Deutschland, oder das Museum für Roma-Kultur in Brno, Tschechien, haben in ihren Sammlungen große Bestände solcher Selbstzeugnisse angelegt und damit maßgeblich zu einer visuellen Gegenerzählung beigetragen.