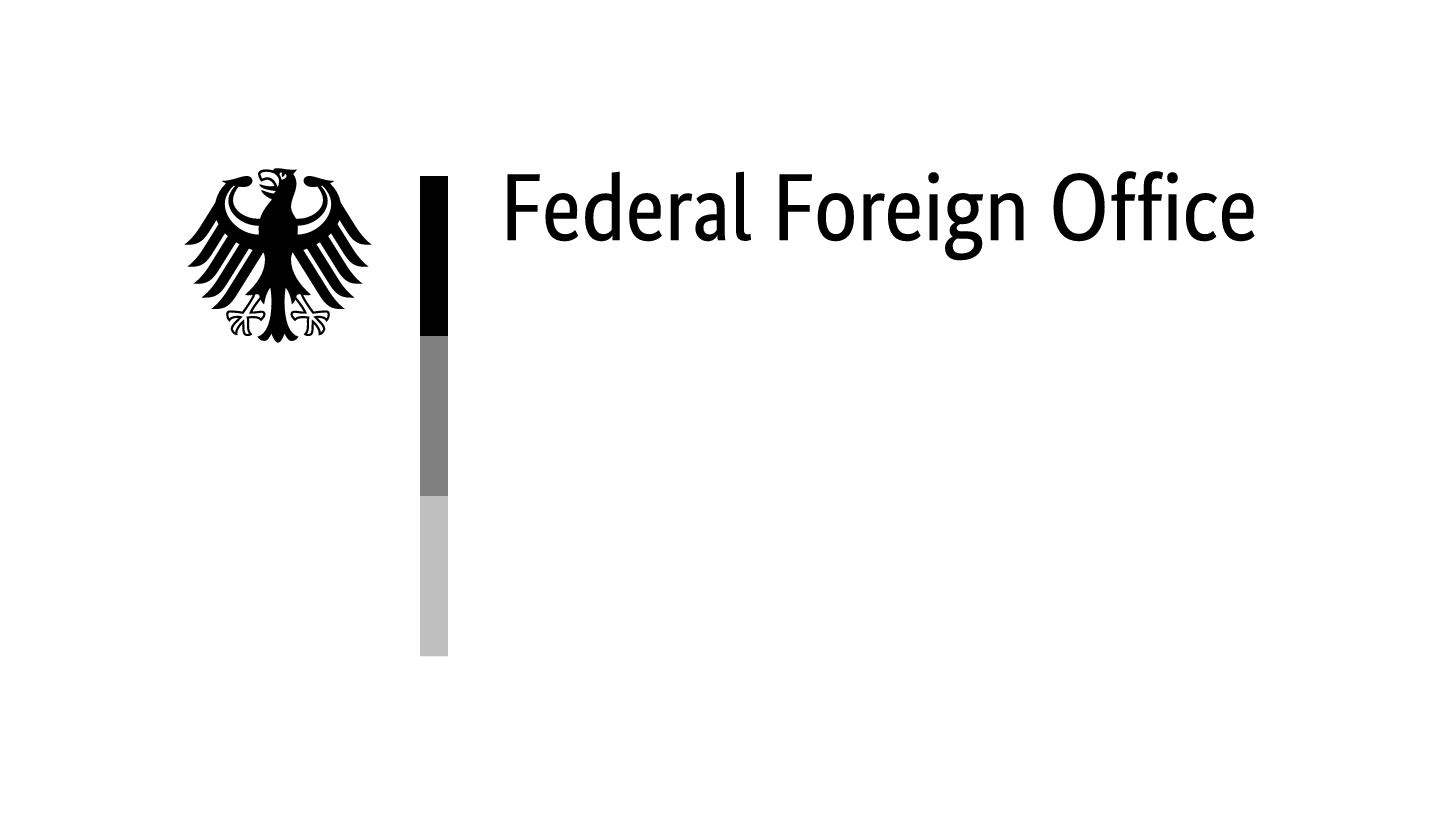Das katholische Kinderheim St. Josefspflege in Mulfingen, Hohenlohekreis im heutigen Baden-Württemberg, Deutschland, diente seit Ende 1938 als zentrale Sammelstelle für Kinder der Sinti:ze in Württemberg. Die Kinder waren aus rassenpolitischen Gründen als Fürsorgezöglinge dorthin überführt worden. Das Heim hat aufgrund des Missbrauchs der Kinder für die Feldforschung von Eva Justin (1909–1966) und deren anschließende Deportation in das Konzentrations– und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau einen hohen Bekanntheitsgrad. Es symbolisiert die rassistische Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen der Sinti:ze und Rom:nja aus der Fürsorge in die Vernichtung.
Einweisungen
Gemäß Erlass des württembergischen Innenministers vom 7. November 1938 sollten in Fürsorgeerziehung befindliche schulpflichtige „Zigeuner und Zigeunerähnliche“ (mit letzteren waren Jenische gemeint) aus Württemberg zentral in der St. Josefspflege untergebracht werden.1Vgl. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 151/09 Bü 442, Erlass des Württembergischen Innenministers, 7. November 1938 („Heimerlass“). Die Zuweisung erfolgte auf der Grundlage eines Gutachtens des Landesjugendarztes Dr. Max Eyrich (1897–1962) in Stuttgart, der kategorisch für eine „Aussonderung“ auf erbbiologischer Grundlage eintrat. Die jüngeren Kinder kamen zunächst in andere Heime und wurden zur Einschulung nach Mulfingen verlegt. Betreut wurden die Kinder der St. Josefspflege von den Barmherzigen Schwestern des Klosters Untermarchtal sowie der Lehrerin Johanna Nägele (1915–2011). Viele waren der staatlichen Fürsorge unterstellt worden, nachdem man ihre Eltern in Konzentrationslager eingewiesen hatte.
Feldforschungen
Im Frühherbst 1942 führte Eva Justin, engste Mitarbeiterin von Robert Ritter (1901–1951) in der Rassenhygienischen Forschungsstelle (RHF), für ihre Dissertation umfangreiche Untersuchungen an ausgewählten 21 Kindern der Sinti:ze in der St. Josefspflege durch, darunter laienpsychologische Tests wie ein sogenanntes „Leistungskartoffellesen“. Im Rahmen dieser Feldforschungen entstanden auch Porträtfotos der Kinder sowie ein 16-mm-Farbfilm.2Ein Teil der Porträtfotos ist abrufbar unter https://www.sintiundroma.org/de/auschwitz-birkenau/deportation-aus-heimen/. Die etwa eineinhalbminütige Filmsequenz ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=A5DDRy0I9rU [Zugriff: 23.02.2025]. 1943 reichte Justin, die seit 1937 an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin (heute Humboldt-Universität) eingeschrieben war, ihre Doktorarbeit an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät im Fachbereich Anthropologie ein. Die Dissertation wurde mit „Gut“ bewertet und erschien 1944 unter dem Titel „Lebensschicksale artfremd erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen“ im Druck. Im Zentrum ihrer Argumentation steht das Dogma ihres Mentors und Vorgesetzten Dr. Robert Ritter von der genetisch bedingten „Erziehungsunfähigkeit“ der „Zigeuner“, deren vor der Geburt festgelegtes „Erbschicksal“ nicht geändert werden könne. Auch wenn ihre im Heim gemachten Beobachtungen dieser Prämisse erkennbar widersprachen, forderte sie zum Schutz des „deutschen Volkskörpers“ ein Ende aller Erziehungsmaßnahmen und bis auf wenige Ausnahmen die Zwangssterilisation von Sinti:ze und Rom:nja.
Deportation am 9. Mai 1944
Am 19. Dezember 1942 – drei Tage nach dem Auschwitz-Erlass des Reichsführers-SS Heinrich Himmler (1900–1945) – forderte der Reichsminister des Innern die „Gau- und Landesjugendämter“ dazu auf, „eine Aufstellung über die in Heimerziehung befindlichen minderjährigen Zigeuner einzureichen“.3Zitiert nach Rose, Den Rauch hatten wir täglich vor Augen, 288. Laut Erlass sollten die Kinder an Angehörige übergeben werden, um sie mit diesen ab März 1943 nach Auschwitz-Birkenau zu deportieren.
Tatsächlich erfolgte die Deportation der Mulfinger Kinder erst am 9. Mai 1944. Der Grund für dieses späte Datum lässt sich aus den überlieferten Akten nicht mit Gewissheit erschließen. In der älteren Literatur wird die Annahme vertreten, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Abholung der Kinder und dem formalen Abschluss und damit der Rechtsgültigkeit von Justins Dissertation. Reimar Gilsenbach (1925–2001) argumentierte, erst nachdem der Verlag am 9. März 1944 120 Exemplare der Druckfassung an die Berliner Universität versandt hatte, „konnte Justin sicher sein, daß sie ihr ,Untersuchungsmaterial‘ nicht mehr benötigte.“4Gilsenbach, „Wie Lolitschai zur Doktorwürde kam“, 118; siehe auch Krausnick, Wo sind sie hingekommen?, 105. Diese vielfach aufgegriffene Deutung ist bei näherer Betrachtung wenig plausibel: Aufgrund der Protektion durch Ritter, der im Machtgefüge des nationalsozialistischen Staates bestens vernetzt war, hatte Justin keinen Grund, ein Scheitern ihrer Promotion zu fürchten. Stephan M. Janker (geb. 1957) verwies 2006 auf einen Briefwechsel der Zentralleitung für das Stiftungs- und Anstaltswesen mit dem Württembergischen Landesjugendamt, der belege, dass „man in Stuttgart spätestens seit Anfang April 1943 mit frei werdenden Heimplätzen in Mulfingen rechnete, ,wenn die noch dort befindlichen Zigeunerkinder anderweitig untergebracht worden sind‘.“5Janker, Die Geschwister Kurz – vier Stuttgarter Sinti-Kinder, 152. Er führte die späte Deportation auf den am 15. Mai 1943 verhängten Aufnahmestopp über den Lagerabschnitt BIIe in Auschwitz-Birkenau zurück, der offiziell erst im März 1944 wieder aufgehoben wurde. Unterstrichen wird diese These dadurch, dass etwa einen Monat nach den Mulfinger Kindern nochmals vier Kinder, diesmal aus dem katholischen Kinderheim St. Josef in Eltmann (Unterfranken), nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, wo sie am 17. Juni 1944 mit einem der letzten Transporte eintrafen.6Staatsarchiv Nürnberg, LRA Uffenheim, Abg. 1956, Nr. 2036; Gedenkbuch Bd. 1, 722 f. und Gedenkbuch Bd. 2, 1326 f.
Der Ablauf der Deportation aus Mulfingen lässt sich weitgehend rekonstruieren. Anfang 1944 erschienen Beamte der Stuttgarter Kriminalpolizei in der St. Josefspflege, um die Personalien der Kinder der Sinti:ze zu überprüfen und ihre Fingerabdrücke zu nehmen, wahrscheinlich auf das dafür vorgesehene „Formular der Hafteinweisung von ‚Zigeunermischlingen‘“. Wenig später erhielt die Heimleitung eine schriftliche Anweisung mit einer Liste derjenigen Kinder, die für einen Transport mit unbekanntem Ziel bereit gemacht werden sollten. Am 7. Mai, einem Sonntag, empfingen die Kinder – auch diejenigen, die eigentlich zu jung dafür waren – in der Hauskapelle die Erstkommunion. Die Heimleitung unternahm darüber hinaus keinen Versuch, die Deportation der Kinder zu verhindern.
Am 9. Mai holten drei Gendarmen 33 Kinder und Jugendliche, die in einer Aufstellung der „Dienststelle für Zigeunerfragen“ der Kriminalpolizeileitstelle Stuttgart vom 14. Juni 1944 als „Zigeunermischlingskinder“ aufgeführt waren, mit dem Postbus ab. Zurück blieb die damals zehnjährige Angela Reinhardt (geb. 1934). Obwohl sie von der RHF als „Zigeunermischling“ klassifiziert worden war und damit zum Personenkreis der zu Deportierenden zählte, stand sie nicht auf der Deportationsliste – vermutlich, weil sie in den Heimunterlagen unter dem Namen ihrer leiblichen Mutter geführt wurde, die keine Sintiza war.
Die Mulfinger Filialoberin Sr. Eutychia Herold (1885–1965) und Johanna Nägele baten die Beamten, ihre Schützlinge zu Beginn begleiten zu dürfen. Der Bus fuhr zum Bahnhof in Künzelsau, wo auf einem Abstellgleis ein Waggon mit vergitterten Fenstern wartete, der bis Crailsheim an fahrplanmäßig abgehende Züge angehängt wurde. Nägele und Herold mussten sich dort von den Kindern verabschieden. In Crailsheim stiegen weitere Personen in den Zug: Albert Kurz (1938–1944) aus dem Kinderheim Baindt, Rosina (1933–1944) sowie Heinz Winter (1941–1944) aus dem Kinderheim Hürbel und die hochschwangere Anna Reinhardt (1916–1944) mit ihren beiden Töchtern Hildegard (1941–1944) und Sophie (1935–1944). Dort wartete außerdem Adolf Scheufele (1892–1981) von der „Dienststelle für Zigeunerfragen“ der Kriminalpolizeileitstelle Stuttgart, der den Abtransport beaufsichtigte. Eine Esslinger Kriminalbeamtin namens Kienzle (weitere Personalien nicht bekannt) begleitete die Insass:innen des Gefangenenwagens bis nach Auschwitz-Birkenau. Nach über 50 Stunden Zugfahrt trafen die 39 Deportationsopfer am 12. Mai dort ein. Die Überlebende Amalie Schaich geb. Reinhardt (1929–2010) berichtete, dass die Mulfinger Kinder im Lagerabschnitt BIIe noch 14 Tage im Häftlingsblock 16 zusammenblieben; danach wurden die kleineren Kinder in den sogenannten „Waisenblock“ verlegt.7Gedenkbuch Bd. 2, 1532–1534.
Frühere Deportationen
Der Transport vom 9. Mai 1944 war nicht die erste Deportation von Kindern aus Mulfingen nach Auschwitz-Birkenau. Bereits am 20. Januar 1944 hatten Kripobeamte die vier Geschwister Maria Delis (1937–1944), Rudi Delis (1935–1944), Luana Schneck (1934–1944) und Siegfried Schneck (1929–1944) in der St. Josefspflege abgeholt. Als Ankunftsdatum in Auschwitz-Birkenau ist der 11. Februar 1944 verzeichnet. Patrizka Georges (1925–1943), die bis Mai 1941 im Mulfinger Heim gelebt hatte und danach als Magd bei einer Bauernfamilie untergebracht war, wurde schon im Frühjahr 1943 nach Auschwitz-Birkenau verschleppt; als ihr Todesdatum wurde der 25. Oktober 1943 registriert. Andere ältere Heiminsass:innen, die nach ihrem Schulabschluss bei Bauern der Umgebung arbeiteten, konnten dem Verfolgungsapparat entgehen.
Nur drei Überlebende
Wie Laura Hankeln (geb. 1991) in ihrer 2024 erschienenen Dissertation zeigen konnte, wurden insgesamt 38 – statt wie bislang angenommen 39 – Kinder und Jugendliche, die in der St. Josefspflege untergebracht gewesen waren, nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur drei von ihnen überlebten: Rosa Georges verh. Alter (1927–unbekannt), Luise Mai verh. Würges (1929–unbekannt) und Amalie Reinhardt verh. Schaich.8Hankeln, Antiziganismus im baden-württembergischen Staatsapparat 1945–1970, 323–328. Die meisten Kinder aus Mulfingen wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in den Gaskammern ermordet.
Andreas Reinhardt (1929–1944), der in der älteren Literatur als weiterer Überlebender angeführt wird, wurde kurz vor dieser Mordaktion in das Konzentrationslager Buchenwald verlegt, aber bereits am 26. September 1944 mit 199 weiteren Kindern und Jugendlichen der Sinti:ze und Rom:nja zurück nach Auschwitz-Birkenau geschickt und dort ermordet.
Bemühungen um juristische Aufarbeitung
Nach der Befreiung machten sich Eltern, die selbst in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen waren, auf die oft langwierige Suche nach ihren in Mulfingen untergebrachten Kindern und erfuhren von ihrem Tod in Auschwitz-Birkenau.9Siehe exemplarisch den Brief von Franziska Kurz an die Oberin der St. Josefspflege vom 30. Januar 1946 https://www.romarchive.eu/de/collection/die-antwort-war-kurz-vernichten/ [Zugriff: 23.02.2025].
Die für die Deportation Verantwortlichen aus dem Polizeiapparat wurden niemals juristisch zur Rechenschaft gezogen. Erst ab Juni 1972 rückte das Verbrechen in den Fokus der Behörden, als sich der Sozialarbeiter Johannes Meister (1918–1989), der zur Verfolgungsgeschichte der Mulfinger Kinder recherchiert hatte, in mehreren Schreiben an das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) wandte und darin explizit die Frage nach den involvierten Tätern aufwarf. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein und beauftragte das LKA mit der Vernehmung von Zeug:innen. Zwischen Januar und Mai 1973 befragten zwei Beamte des LKA neben Meister und der ehemaligen Lehrerin Nägele auch die drei überlebenden Frauen. Während Rosa Alter (geb. Georges) erklärte, sie wolle an die vergangene Zeit nicht mehr erinnert werden, machten Luise Würges (geb. Mai) und Amalie Schaich (geb. Reinhardt) detaillierte Angaben über den Ablauf der Deportation und ihre von Gewalt und Massenvernichtung geprägten Lagererfahrungen. Da sie zu den Tätern keine weiterführenden Hinweise geben konnten und zahlreiche Zeug:innen mittlerweile verstorben waren, stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Verfahren am 24. Januar 1974 ein.10Hankeln, Antiziganismus im baden-württembergischen Staatsapparat 1945–1970, 311–323.
Lebendige Erinnerung
Erst die TV-Dokumentation „Auf Wiedersehen im Himmel“ unter der Regie von Michail Krausnick (1943–2019) und Romani Rose (geb. 1946), die am 4. August 1994 erstmals in der ARD ausgestrahlt wurde, schuf eine breite öffentliche Aufmerksamkeit für die Leidensgeschichte der Mulfinger Kinder. Der Film gibt den Zeugnissen der Überlebenden breiten Raum. Er stellt die Ereignisse in der St. Josefspflege in den größeren Zusammenhang des Genozids an den Sinti:ze und Rom:nja und wirft die Frage nach der Verantwortung der Katholischen Kirche auf.11Ein Auszug des Films ist abrufbar unter https://www.romarchive.eu/en/collection/well-meet-again-in-heaven/ [Zugriff: 23.02.2025].
Die „Mulfinger Sinti-Kinder“, deren Geschichte in zahlreiche Ausstellungen und Bildungsprojekte eingegangen ist,12Exemplarisch https://romasinti.eu/de/#story/amalie-schaich-reinhardt [Zugriff: 23.02.2025]. haben heute einen festen Platz in der Erinnerungskultur. Am 2. Juni 1984 wurde am Hauptgebäude der St. Josefspflege eine Gedenktafel mit den Namen der Kinder eingeweiht, die auf Initiative sowohl der dortigen Mitarbeiter:innen als auch des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma zurückgeht. Das Heim setzt sich im Rahmen des Projekts „Erziehung nach Auschwitz“ intensiv mit seiner Geschichte auseinander.13Siehe https://www.josefspflege.de/bischof-von-lipp-schule/erziehung-nach-auschwitz/ [Zugriff: 23.02.2025]. Bis heute ist Mulfingen sowohl für die Angehörigen der Opfer als auch für die Zivilgesellschaft ein wichtiger Bezugspunkt des Gedenkens. Insbesondere zu den Jahrestagen der Deportation wird regelmäßig an die ermordeten Kinder erinnert.14Exemplarisch https://www.josefspflege.de/news/artikel/news/gedenkfeier-zum-80-jahrestag-der-ermordeten-sinti-kinder-der-st-josefspflege/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=9d7c47f23db0196730e4f65c1bbd9711&L=0 [Zugriff: 23.02.2025].
Ein vom Künstler Wolfram Isele (geb. 1952) geschaffenes Denkmal für die Mulfinger Kinder ist seit dem Jahr 2000 im Foyer des Stuttgarter Jugendamts zu sehen; es steht auch für die Verstrickung der Sozialverwaltung und der Sozialen Arbeit in die NS-Verbrechen.15Vgl. https://www.stuttgart.de/organigramm/adresse/wolfram-isele-aktenordnung-denkmal-fuer-die-mulfinger-kinder.php [Zugriff: 23.02.2025].
Für die Geschwister Kurz aus Bad Cannstatt wurden Stolpersteine vor ihrer ehemaligen Wohnstätte in der Badergasse verlegt.16Vgl. https://www.stolpersteine-stuttgart.de/presse/stolpersteine-in-bad-cannstatt-von-cannstatt-ueber-mulfingen-in-den-tod/ [Zugriff: 23.02.2025]. In Nürtingen erinnert seit Juli 2015 eine von dem britischen Bildhauer Robert Koenig (1951–2023) geschaffene Holzskulptur an Anton Köhler (1932–1944), der in der Stadt geboren und mit zwölf Jahren in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde.17Vgl. https://web.archive.org/web/20160203195229/http://ns-opfer-nt.jimdo.com/w%C3%A4chter-der-erinnerung/ [Zugriff: 23.02.2025].
Auch die Auseinandersetzung mit den Täter:innen ist noch nicht abgeschlossen. Der 2021 an die Bundesregierung übergebene Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus empfiehlt der Humboldt-Universität zu Berlin, den Doktortitel von Eva Justin „in formalrechtlicher, wissenschaftlicher und wissenschaftsethischer Hinsicht“ zu überprüfen und gegebenenfalls abzuerkennen.18Unabhängige Kommission Antiziganismus, Perspektivwechsel. Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation, 370.