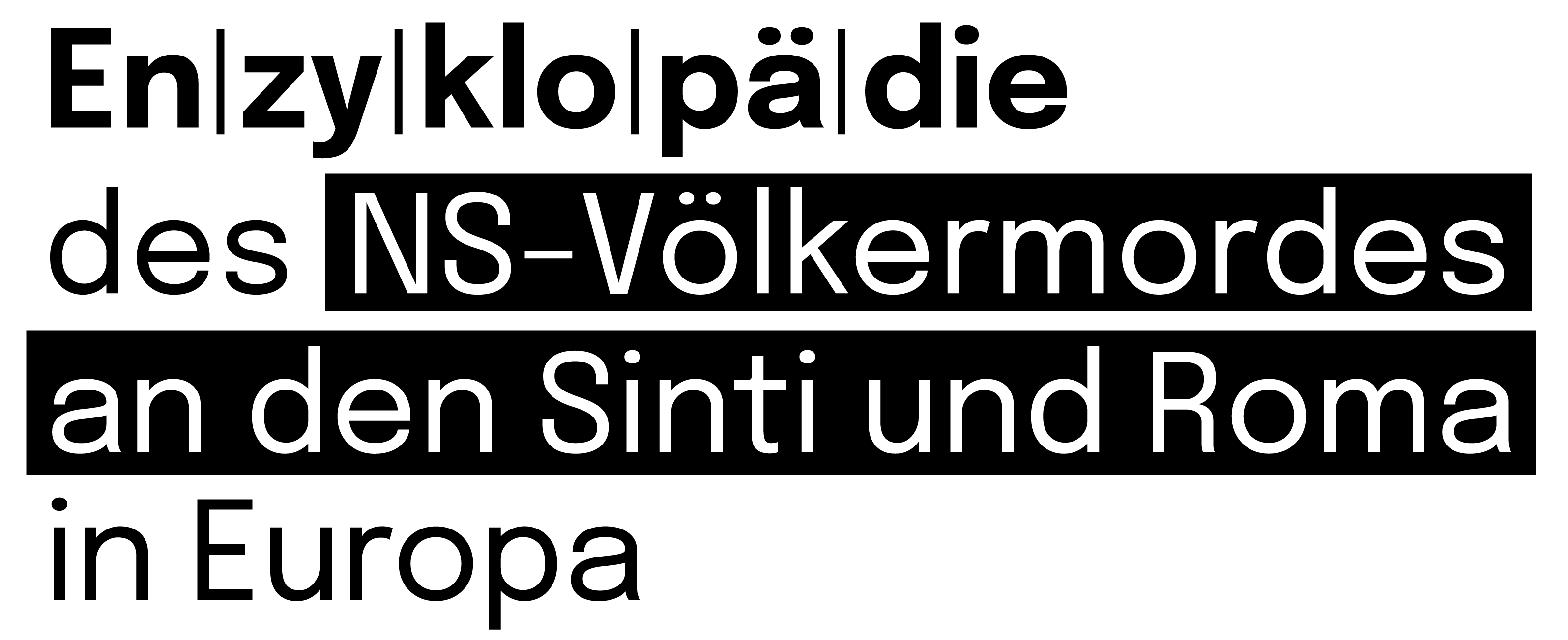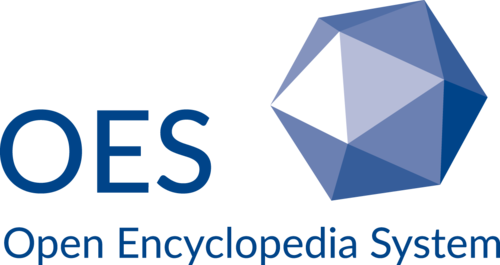Unter dem Begriff „Wiedergutmachung“ werden die nach 1945 in und von Deutschland ergriffenen Maßnahmen zugunsten der Opfer des Nationalsozialismus verstanden. Die Wiedergutmachung umfasste vom Anspruch her den Ausgleich von persönlich erlittenen Schäden etwa an Gesundheit, im beruflichen Fortkommen oder durch Verlust von Angehörigen ebenso wie die Erstattung geraubten Eigentums. Im Zusammenhang mit der Wiedergutmachung sind neben der bundesdeutschen Gesetzgebung die von den Alliierten eingeleiteten Maßnahmen, bilaterale Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten sowie die diversen ergänzenden Programme seit den 1980er-Jahren zu betrachten. Die Opfergruppe der Sinti:ze und Rom:nja sah sich vielfach einer Abwehr ihrer Ansprüche ausgesetzt und konnte erst spät eine angemessenere Berücksichtigung erwirken.
Der Begriff „Wiedergutmachung“ gerät auch selbst immer wieder in die Kritik. Seine Gegner:innen, die ihn im wörtlichen Sinn verstehen, weisen auf die Unmöglichkeit des „Wiedergutmachens“ im Sinne einer abschließenden Schuldtilgung hin. Der im Grunde unübersetzbare deutsche Begriff hat sich deshalb in Israel nie durchgesetzt, wo stattdessen von „shilumim“ die Rede ist, was nüchterner und den rein materiellen Charakter betonend „Zahlungen“ bedeutet. Auch unter deutschen Sinti:ze und Rom:nja wird der Begriff nicht überall geschätzt und oft mit Anführungszeichen versehen. Die Sintiza und frühe Aktivistin Melanie Spitta (1946–2005) brachte ihr Unbehagen mit dem Terminus schon 1987 im Titel ihres Films über das Phänomen zum Ausdruck: „Das falsche Wort“.1Das falsche Wort, Regie: Katrin Seybold, Drehbuch: Melanie Spitta, D 1987. Dennoch hat sich die Rede von „Wiedergutmachung“ in Wissenschaft, Politik und öffentlichem Diskurs aus pragmatischen Gründen fest etabliert, weil es bei aller Unzufriedenheit nie gelungen ist, einen gleichwertig vielseitigen Oberbegriff zu prägen, der die unterschiedlichen Facetten des Phänomens in ähnlicher Weise abdecken könnte.2Zudem hat Goschler, Wiedergutmachung, 25, darauf verwiesen, dass die Begriffsgeschichte des Verbs „wiedergutmachen“ als Synonym für „ersetzen, bezahlen, sühnen“ eine intendierte Relativierung der Verbrechen nicht hergebe.
Ideen-, politik- und rechtsgeschichtliche Kontextualisierung
Die Idee dessen, was später die Institution der Wiedergutmachung wurde, war eine Reaktion auf den Schock der Menschheitsverbrechen, die das nationalsozialistische Deutschland begangen hatte. Wiedergutmachung zielte insofern auf die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Moral nach „Auschwitz“. Sie war zugleich eine praktische Antwort auf die Frage nach dem Wie des Weiter- und Zusammenlebens in einer Gesellschaft, die in die Abgründe dessen geblickt hatte, was der Historiker Dan Diner (geb. 1946) als „Zivilisationsbruch“ bezeichnet hat.3Diner, Zivilisationsbruch. Auch verbanden sich mit Wiedergutmachung unterschiedliche politische und materielle Interessen von Akteursgruppen, die schon während des Zweiten Weltkrieges als Vordenker in Erscheinung getreten waren: deutsche Oppositionelle, jüdische Individuen und internationale Organisationen sowie – in unterschiedlichem Ausmaß – die Alliierten. Schließlich erkannte ein maßgebender Teil der (west-)deutschen politischen Eliten in der Wiedergutmachungspolitik ein beschleunigendes Instrument der Reintegration der Bundesrepublik in internationale Bündnissysteme.
Als die aus der Kriegszeit stammenden Überlegungen in erste Rechtsnormen gegossen wurden, stand Wiedergutmachung nicht allein, sondern fügte sich in eine breit gefächerte deutsche Politik der Kriegsfolgenbewältigung ein. Während mit Kriegsopferversorgung, Lastenausgleichs- und Allgemeinem Kriegsfolgengesetz primär die sich in weiten Teilen selbst als Opfer sehende deutsche Mehrheitsbevölkerung bedacht werden sollte, gehörte die Wiedergutmachungsgesetzgebung zusammen mit der Entnazifizierung, der Ahndung von NS-Verbrechen oder der Rehabilitierung von Regimegegner:innen durch Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile zu dem Bündel vergangenheitspolitischer Maßnahmen, die man unter dem Stichwort der „transitional justice“ fassen kann.
Wiedergutmachung war historisch präzedenzlos. Regelungen von Schadenersatz zivilrechtlicher Art existierten in den Rechtsordnungen unterschiedlicher Kulturen seit dem Altertum. Jedoch lag dabei die Vorstellung fern, der Staat bzw. Rechtsstifter selbst könnte Verursacher eines nachträglich auszugleichenden Unrechts sein. Auch die in den Bereich des Völkerrechts fallenden Kriegsreparationen waren strukturell anders gelagert, denn hier wurde zwar ein militärisch besiegter Staat in Haftung genommen, doch Profiteure waren wiederum (siegreiche) Staaten, die sich für ihre materiellen Kriegsverluste schadlos halten wollten. Bei der Wiedergutmachung waren individuelle Opfer staatlicher Verfolgung die Begünstigten; und sie erhielten Leistungen aus den Händen eines Staates, der – über das Konstrukt der Rechtsnachfolge – seine eigenen Bürger:innen entschädigte. Damit gewann die deutsche NS-Wiedergutmachung Modellcharakter und bildete seither den Referenzmaßstab bei der Ausarbeitung ähnlicher Gesetzeswerke in Ländern, die ebenfalls vor der Aufarbeitung historischen Staatsunrechts in demokratischen Transitionsprozessen standen.
Rückerstattung, Entschädigung, Globalentschädigung
Wiedergutmachung stellt einen Oberbegriff dar, der sich in die eigenständigen Rechtsgebiete Rückerstattung (oder Restitution) und Entschädigung aufspaltet. Während es bei der Restitution um materielle Schäden, also um feststellbare Güter und Vermögenswerte – wie etwa Immobilien, Bankguthaben oder Schmuck – ging, die während der NS-Zeit geraubt oder anderweitig entzogen worden waren, sollte die Entschädigung die immateriellen oder Personenschäden abdecken, die beispielsweise aus Inhaftierungszeiten, davongetragenen Krankheiten, beruflichen Nachteilen oder auch dem Tod von Angehörigen entstanden waren. In der Rückerstattung bestand die Grundidee darin, dass eine konkrete Sache, die unrechtmäßig entzogen worden war, zurückgegeben und damit eine ursprüngliche Rechtsbeziehung wiederhergestellt bzw. – weniger juristisch gesprochen – die Eigentümer:in wieder zur Besitzer:in gemacht wurde. Wo das nach mehreren Jahren wegen fehlender Wiederauffindbarkeit der entzogenen Sache nicht mehr möglich war, musste ein Schadenersatz in Geld bemessen werden.
Bei der auf immaterielle Schäden fokussierenden Entschädigung war die – in der Praxis freilich oft willkürlich erscheinende – Umrechnung ideeller Werte (z. B. ein menschliches Leben, zwei Jahre Haft im Konzentrationslager, lebenslange Kinderlosigkeit durch Zwangssterilisation etc.) in Geldbeträge die Regel. Für jeden in Haft verbrachten Monat beispielsweise setzte das Bundesentschädigungsgesetz 150 DM an. Ein weiterer Unterschied zwischen Restitution und Entschädigung liegt in der Frage des Wiedergutmachungsschuldners begründet: Rückerstattungspflichtig war stets der bzw. die Nachbesitzer:in des geraubten Objekts – in den meisten Fällen also Privatpersonen, die von der NS-Raubpolitik oder der „Arisierung“ profitiert hatten. Der Staat trat deshalb in diesen Fällen regelmäßig nur als Garant des Verfahrens auf, weshalb auch die zuständige Verwaltungsinstanz mancherorts die neutrale Bezeichnung „Schlichter für die Wiedergutmachung“ führte. Die Ansprüche auf Entschädigung hingegen trafen den deutschen Staat als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches unmittelbar.
Ferner ist bei der Entschädigung die Unterscheidung zwischen Individual- und Globalentschädigung von Bedeutung. Letztere sind in völkerrechtlichen Verträgen vereinbarte Zahlungen der Bundesrepublik an ausländische Staaten. Insofern sind sie den eingangs von Wiedergutmachung abgegrenzten Reparationen verwandt, beziehen sich aber nicht auf allgemeine Folgeerscheinungen eines Verteidigungskrieges, sondern auf die explizit nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen und Verbrechen, die das NS-Besatzungsregime in diesen Ländern an zivilen Opfern verübte. An diese ausländischen Verfolgungsopfer, die von der deutschen Individualentschädigung aufgrund des eingebauten „Territorialitätsprinzips“ – das die Antragsberechtigung an einen Wohnsitz in Westdeutschland oder Westberlin bzw. eine Beziehung zum Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 knüpfte – in der Regel ausgeschlossen waren, sollten die Zahlungen dann in nationaler Eigenverantwortlichkeit weiterverteilt werden. Weitgehend unbekannt ist dabei, inwiefern Sinti:ze und Rom:nja als Bürger:innen dieser Länder überhaupt bedacht wurden.
Vorbild dieser Globalabkommen war das Luxemburger Abkommen vom 10. September 1952 mit Israel und der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden DM. Zwischen 1959 und 1964 folgten weitere bilaterale Abkommen geringeren Umfangs mit den zwölf westeuropäischen Staaten Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz, die ein Gesamtvolumen von 971 Millionen DM aufbrachten. Mit mittel- und osteuropäischen Staaten wurden vor dem Hintergrund des „Kalten Krieges“ keine solchen Abkommen geschlossen, obwohl dort die Mehrheit aller Opfer des Nationalsozialismus lebte. Keine Verpflichtung zu solch äußerer Wiedergutmachung akzeptierte die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Aus ihrem antifaschistischen Selbstverständnis heraus sah sie sich als Gegenentwurf zum NS-Regime und leugnete jede Verantwortlichkeit für dessen Verbrechen. Ferner argumentierte sie, mit den Reparationen an die Sowjetunion und den Demontagen, die vor Gründung der DDR auf ihrem Territorium – also der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) – erfolgt waren, bereits ausreichend Wiedergutmachung geleistet zu haben.
Die Opfergruppe der Sinti:ze und Rom:ja: Frühe Nachkriegsjahre
Anfangs waren die treibenden Kräfte für eine Versorgung der Opfer die Alliierten, wobei speziell die amerikanische Militärregierung „Schrittmacher“4Goschler, Wiedergutmachung, 310. der Entwicklung war.5Anders Hudemann, „Anfänge der Wiedergutmachung,“der besonders das Engagement der Franzosen betont. Vor allem die Rückerstattung wurde in der US-Zone mit dem Militärregierungsgesetz Nr. 59 vom 10. November 1947 relativ rasch geregelt. Eine politische Lösung der Entschädigungsfrage war nicht zuletzt deshalb komplizierter, weil hier die öffentliche Hand in der Schuldnerrolle war und die Frage der Finanzierbarkeit gründlicher Erörterungen bedurfte. In den Besatzungszonen ergingen zunächst lediglich Anweisungen zur Bildung von regional oder lokal verankerten „Betreuungsstellen“ oder „Sonderhilfsausschüssen“. Diese trugen, personell und institutionell eng mit den nach 1945 entstandenen Verbänden von Verfolgten verzahnt, in den ersten Jahren die Hauptarbeit der Wiedergutmachung und prägten ihr Gesicht als vorwiegend fürsorgerische Institution, die bedürftigen Verfolgten in der allgemeinen Mangelverwaltung der frühen Nachkriegszeit einen bevorzugten Zugang zu Gütern des täglichen Bedarfs vermittelte.
In dieser Phase der spontan und dezentral entstandenen, halb-staatlich getragenen und karitativ sowie rechtsunverbindlichen Entschädigung bestanden für Sinti:ze und Rom:nja gute Chancen, als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt zu werden. Das rigorose Vorgehen des NS-Staates gegen „Zigeuner“ war offenbar bekannt, sodass der Verweis auf die Zugehörigkeit zur Minderheit oftmals genügte, um in den Besitz der Verfolgtenausweise der Betreuungsstellen zu gelangen.6Vgl. von dem Knesebeck, The Roma Struggle for Compensation, 73, 96; Reuss, Kontinuitäten der Stigmatisierung, 104, 118.
Enger Kreis von Anspruchsberechtigten
Ab Ende der 1940er-Jahre machten Sinti:ze und Rom:nja häufig schlechtere Erfahrungen. Diese zweite, bis in die Mitte der 1960er-Jahre reichende Phase zeichnet sich durch die Verabschiedung von Gesetzen aus, die das Betreuungsangebot für Verfolgte in einen Rechtsanspruch auf Entschädigung transformierten. Dieser für die Verfolgten zunächst positive Prozess der gesetzlichen Normierung erfolgte anfangs auf Länderebene und wurde später bundesweit vereinheitlicht. Das am 26. April 1949 vom Süddeutschen Länderrat erlassene US-Entschädigungsgesetz (US-EG) setzte neue Standards und wurde zum Referenzrahmen der weiteren Diskussionen. Darin hatte sich allerdings ein zentrales Prinzip der Wiedergutmachung irreversibel durchgesetzt: der Einschluss bestimmter Verfolgtengruppen zum Preis des Ausschlusses anderer. Bewusst wollten die Gesetzgeber nicht alle entschädigen, die zwischen 1933 und 1945 Leid erfahren hatten, sondern diskutierten intensiv die Grenze zwischen „spezifisch nationalsozialistischer“ Verfolgung und allgemeiner Unbill des Krieges sowie zwischen würdigen und vermeintlich unwürdigen Opfern.
Schließlich wurde der Kreis der Wiedergutmachungsberechtigten recht eng gezogen und ausschließlich eine Verfolgung aufgrund politischer Überzeugung, der „Rasse“, des Glaubens oder der Weltanschauung konnte Entschädigungsansprüche begründen. Unstrittig war demnach nur noch die Anerkennung von Juden:Jüdinnen, politisch Verfolgten und Zeugen Jehovas. Eine anders motivierte Wertigkeitshierarchie der Opfer gab es in der DDR. Hier wurde vorrangig diskutiert, inwiefern der aktive Widerstand gegen das NS-Regime prämiert werden müsse, was ab 1965 durch die Besserstellung der „Kämpfer gegen den Faschismus“ gegenüber bloßen „Opfern des Faschismus“ realisiert wurde. „Deutsch-deutsche Gemeinsamkeiten“7Goschler, „Zwei Wege der Wiedergutmachung?,“ 128. hingegen prägten beiderseits des Eisernen Vorhangs die weitgehende Ausgrenzung gesellschaftlich marginalisierter Gruppen wie Zwangssterilisierte, „Euthanasieopfer“, Kriminelle, „Asoziale“ und teilweise auch Sinti:ze und Rom:nja.
Eine der größten Hürden in der Wiedergutmachung stellte für Sinti:ze und Rom:nja in Ost und West die sich nach 1945 durchsetzende, verengte Auffassung von „rassischer Verfolgung“ dar. Nur wenn der Grund einer Verfolgungsmaßnahme eindeutig im anthropologischen Rassismus gefunden wurde, der auf das Kollektiv der Sinti:ze und Rom:nja als Angehörige einer fremden „Rasse“ zielte, wurde das Vorliegen „rassischer“ Verfolgung angenommen. Demgegenüber wurden jene Maßnahmen, die im Zeichen der „Rassenhygiene“ gegen soziale Unterschichten und marginalisierte Gruppen der „eigenen“ Bevölkerung begangen worden waren, nicht als „typisch nationalsozialistisch“ bewertet. In der Praxis war eine säuberliche Unterscheidung von „rassenhygienischen“ und -anthropologischen Verfolgungsmotiven der Täter:innen freilich kaum möglich, zumal während des Nationalsozialismus Sinti:ze und Rom:nja unter Rückgriff auf antiziganistische Topoi pauschal der „Asozialität“ oder als „Arbeitsscheue“ bezichtigt und oftmals unter diesen Kategorien in die Konzentrationslager eingewiesen worden waren.
Debatte um den Beginn „rassischer“ Verfolgung
Bald bildete sich die Praxis heraus, sich an dem Zeitpunkt zu orientieren, zu dem eine Verfolgungsmaßnahme eingetreten war. Die Entschädigungsgerichtsbarkeit stritt einige Jahre um den Zeitpunkt des Umschlagens einer Verfolgung Einzelner aus Gründen sozialer Devianz und Delinquenz in eine kollektive Verfolgung aller „Zigeuner“. Unter Verwerfung anderer, für die Sinti:ze und Rom:nja günstigerer Deutungsweisen etablierte sich als herrschende Lehre, dass eine kollektive „rassische“ Verfolgung erst mit den auf Grundlage des Auschwitz-Erlasses durchgeführten Massendeportationen im Frühjahr 1943 eingesetzt habe. Diese Rechtsauffassung wurde am 7. Januar 1956 in einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zementiert. Danach konnten Sinti:ze und Rom:nja, bis auf wenige Einzelfälle, für die Jahre 1933 bis 1943 keine Entschädigung erhalten. Besonders für die Tausenden Opfer, die seit 1935 in Zwangslagern hatten leben müssen, 1938 im Rahmen der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ oder 1940 im Zuge der Mai-Deportationen verschleppt worden waren, hatte dieser Justizirrtum fatale Folgen. Andererseits bedeutete das Karlsruher Urteil auch eine Bestätigung dessen, was auch vorher von Ämtern und Gerichten in weitgehendem Konsens anerkannt war: Der Gruppe der überlebenden Auschwitzhäftlinge wurde eine Entschädigung in nahezu allen Fällen zugebilligt.
Der Übergang der Gesetzgebungskompetenz auf den Bund, der nach schwierigen Verhandlungen zwischen dem Wiedergutmachungsausschuss des Bundestages, dem Bundesrat und dem tendenziell bremsenden Bundesfinanzministerium am 18. September 1953 durch Verabschiedung des sogenannten Bundesergänzungsgesetzes (BErG) vollzogen wurde, wirkte sich auf den für Sinti:ze und Rom:nja maßgeblichen Grundkonflikt, ab wann die NS-„Zigeuner“-Politik Anzeichen einer kollektiven Vernichtungsabsicht trug, kaum aus. Die bundesweite Vereinheitlichung der bestehenden Regelungen auf dem Mindeststandard des US-EG, das als das bis dahin umfassendste und für die Verfolgten günstigste Gesetz galt, war notwendig geworden, weil gleich zwei von der Bundesregierung unterzeichnete internationale Verträge diese Erwartungshaltung formuliert hatten: der am 26. Mai 1952 unterzeichnete Überleitungsvertrag zwischen den westlichen Alliierten und der Bundesregierung und das bereits erwähnte Luxemburger Abkommen, dessen Haager Protokolle das Versprechen auf eine bundeseinheitliche Individualentschädigung enthielt.
Dennoch gelang die Einigung auf das BErG erst knapp vor dem Ende der ersten Legislaturperiode des Bundestags, weshalb Einigkeit darüber herrschte, dass es sich bei dieser legislativen Sturzgeburt nur um ein Provisorium handeln könne. Sorgfältiger war dann das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom 29. Juni 1956 ausgestaltet. Mit der Verabschiedung des Bundesrückerstattungsgesetzes (BRüG) am 29. Juli 1957 war die Phase der Rechtsangleichung in Westdeutschland abgeschlossen.
Benachteiligung von Sinti:ze und Rom:nja
Neben den behördlichen Zweifeln an einer „rassischen“ Verfolgung erschwerten weitere Faktoren die Entschädigung für Sinti:ze und Rom:nja. Dabei handelte es sich oft um Strukturmerkmale der Wiedergutmachung, die alle Antragsteller:innen gleichermaßen betrafen, sich auf Sinti:ze und Rom:nja aber besonders erschwerend auswirkten. Dabei spielten antiziganistische Stereotype, Traditionen der sozioökonomischen Marginalisierung und Kriminalisierung der Minderheit sowie verfolgungsbedingte Nachwirkungen, etwa durch Schul-, Berufs- und Heiratsverbote, eine Rolle. Die prinzipielle Bevorzugung wirtschaftlicher Schäden gegenüber Personenschäden konnte Sinti:ze und Rom:nja zum Nachteil gereichen, wenn sie ohnehin in ökonomisch bescheidenen Verhältnissen gelebt hatten oder ihre materiellen Verluste – vermehrt Mobilien wie Schmuck, Wohnwagen und wertvolle Instrumente – nicht belegbar waren. Beanspruchten Sinti:ze und Rom:nja doch Leistungen wegen Schäden im beruflichen Fortkommen bzw. in ihrer Ausbildung, so wurde ihnen eine Karriereorientierung und die Befähigung zu wirtschaftlichem Erfolg oft reflexhaft abgesprochen und Betroffene kostete es einige Mühe, nachzuweisen, dass nicht etwa genetisch oder kulturell veranlagter Hang zum Müßiggang, sondern die staatliche Verfolgungspolitik für materielle Einbußen ursächlich war.
Andere Sinti:ze und Rom:nja waren davon betroffen, dass die Anerkennung von Zwangssterilisation als NS-Unrecht insgesamt defizitär war. Vor allem der Nachweis einer mindestens 25%igen (bis 1956 einer 30%igen) „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ (MdE) verursachte Schwierigkeiten, zumal eine negative Beeinflussung der Erwerbsfähigkeit jahrelang nur einwandfrei feststellbaren, physischen Beschwerden zugetraut wurde. Überhaupt stellten die peniblen medizinischen Begutachtungen, die bei der Beanspruchung von sogenannten „Gesundheitsschäden“ obligatorisch waren, für viele Sinti:ze und Rom:nja eine immense Belastung dar, weil sie als Entblößung der Intimsphäre empfunden wurden und vielfach retraumatisierend wirkten, indem sie schmerzliche Erinnerungen an medizinische Experimente oder andere in der NS-Zeit von Ärzt:innen begangene Verbrechen wachriefen.
Die Beschränkung der Vererbbarkeit eines Entschädigungsanspruchs auf Witwen war ein weiteres Problem, weil ein Teil der Familien aus der Minderheit – sei es kulturbedingt aus freien Stücken, sei es aufgrund der „Nürnberger Gesetze“ – nicht auf rechtsgültig geschlossenen Zivilehen gründete.
Auch kleinere Vermerke im Strafregister konnten, im Bemühen um eine vom Gesetz intendierte Aussiebung der „unwürdigen“ Opfer, zum Ausschluss von Wiedergutmachung führen. Sinti:ze und Rom:nja waren diesbezüglich mehrfach benachteiligt: Schon vor 1933 und auch nach 1945 wurden Angehörige der Minderheit von der Kriminalpolizei mit besonderem Nachdruck kontrolliert und kriminalisiert. Verstöße gegen die spezifischen, nur gegen Sinti:ze und Rom:nja ergangenen NS-Erlasse blieben nach 1945 als „Vorstrafen“ aktenkundig. Dies bestärkte das antiziganistische Wahrnehmungsmuster einer angeblich „kriminellen Veranlagung“ und ließ die Ämter folglich auf kriminalpräventive Verfolgungsgründe schließen – was gesetzliche Ansprüche zunichtemachte.
Ebenso wurde das „Territorialitätsprinzip“ des Entschädigungsrechts in manchen Regionen genutzt, um Anträge von Sinti:ze und Rom:nja abzulehnen, indem deren deutsche Staatsbürgerschaft angezweifelt wurde. Deren Nachweis war für die Betroffenen – infolge der Aberkennung während der NS-Zeit und dem gleichzeitigen Verlust von Papieren durch Verfolgungs- und Kriegseinwirkung – oftmals nicht zu erbringen. Erschwerend kam hinzu, dass die zuständigen Behörden Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Sinti:ze und Rom:nja besonders restriktiv handhabten, da oftmals die Überzeugung vorherrschte, dass „Zigeuner“ keine Deutschen sein könnten.8Fings/Sparing, Rassismus, Lager, Völkermord, 361–367.
Schließlich wirkten sich Analphabetismus und verfolgungsbedingt verschärfte Bildungsdefizite nachteilig aus. Nicht nur war es mühsam, sich über Jahre hinweg externe Schreibhilfe zur Bewältigung des Schriftverkehrs mit den Behörden organisieren zu müssen. Auch war es für Leseunkundige eine besondere Herausforderung, die im Behördendeutsch verfassten, sich auf ein komplexes System an Paragrafen und Bestimmungen beziehende Bescheide zu verstehen und ihre Angemessenheit richtig einzuschätzen.
Immer wieder wurde schließlich der skandalöse Umstand betont, dass die Wiedergutmachungsämter in den Verfahren von Sinti:ze und Rom:nja mit der Kriminalpolizei zusammenarbeiteten. Kriminalbeamte, und mithin eben jene Berufsgruppe, die den Völkermord an den deutschen Sinti:ze und Rom:nja operativ verantwortet hatte, wurden zuweilen als Gutachter angefragt, um über die Rechtmäßigkeit der Entschädigungsansprüche ihrer früheren Opfer mitzuentscheiden. In Württemberg-Baden war die Praxis der Hinzuziehung der Kriminalpolizei zwischen 1950 und 1952 sogar obligatorisch vorgeschrieben, weil – so stand es in einem Runderlass des württemberg-badischen Justizministeriums vom 22. Februar 1950 – „Zigeuner und Zigeuner-Mischlinge […] überwiegend nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen [ihrer] asozialen und kriminellen Haltung verfolgt und inhaftiert worden“ seien.9Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, EA 4/202 Bü 11/11, Runderlass des Justizministeriums Württemberg-Baden, Abt. VI, betr. Wiedergutmachungsanträge der Zigeuner, 22.02.1950, Bl. 1330.
In der Rückerstattung scheint die Position der Sinti:ze und Rom:nja hingegen besser gewesen zu sein. Auch wenn bislang Forschungsergebnisse noch spärlich sind, so wurde zumindest für die Bezirke Arnsberg und Braunschweig gezeigt, dass Minderheitsangehörige – entgegen der antiziganistisch vorgeformten Annahme, dass Besitz, der im Verfolgungsprozess hätte entzogen werden können, ohnehin kaum vorhanden gewesen war – sowohl in der frühen Nachkriegszeit als auch nach dem BRüG fortlaufend Restitutionsanträge stellten und dass ihnen ihre Immobilien oder anderen Güter in den meisten Fällen tatsächlich zurückerstattet wurden.10Vgl. von dem Knesebeck, The Roma Struggle for Compensation, 195–220.
Das BEG-Schlussgesetz
Die Novellierung des BEG durch das BEG-Schlussgesetz (BEG-SG) am 14. November 1965 läutete eine dritte Phase der Wiedergutmachung für Sinti:ze und Rom:nja ein, die sich, ermöglicht von liquider werdenden Staatshaushalten und begünstigt durch allgemeine Liberalisierungstendenzen, durch mehr Großzügigkeit und Entgegenkommen auszeichnete. Schon am 18. Dezember 1963 hatte der BGH seine bisherige Rechtsauffassung korrigiert und verkündet, dass „rassische“ Gründe für die Verfolgung der Sinti:ze und Rom:nja schon vor 1943 mitursächlich gewesen sein konnten. Dies war unter anderem auf publizistischen und lobbyistischen Druck zustande gekommen, den insbesondere jüdische Wiedergutmachungsexperten in Solidarität mit der Opfergruppe der Sinti:ze und Rom:nja aufgebaut hatten. Einflussreich war vor allem der 1961 in einer Fachzeitschrift zum Wiedergutmachungsrecht erschienene kritische Artikel des Senatspräsidenten am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main, Franz Calvelli-Adorno (1897–1984).11Calvelli-Adorno, „Die rassische Verfolgung der Zigeuner“.
Als wenig später die Novellierung des BEG-SG anstand, wurde die höchstrichterliche Revision politisch umgesetzt. So wurde es „Zigeunern“, die erstmals überhaupt in einem Gesetzestext zur Wiedergutmachung explizit genannt wurden, erlaubt, über bereits rechtskräftig abgelehnte Ansprüche neu entscheiden zu lassen, sofern eine Entschädigung für die Zeit vor dem 1. März 1943 mit Verweis auf das nunmehr revidierte BGH-Urteil von 1956 verweigert worden war.12Vgl. Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG-Schlußgesetz), 14.09.1965, BGBl. 1965 I, S. 1315–1340, hier S. 1335, Art. IV, Abs. 1 (2).
Von dem Neuantragsrecht wurde in der Folge rege Gebrauch gemacht, allerdings konnte der späte „Lernprozeß“13Frei, Brunner und Goschler, „Komplizierte Lernprozesse.“ das vielen Sinti:ze und Rom:nja widerfahrene doppelte Unrecht aus Verfolgung und verweigerter Entschädigung nicht rückgängig machen, da manche Betroffene inzwischen verstorben waren oder ihr Verfahren aus anderen Gründen nicht weiter betreiben konnten oder wollten. Im gleichen Zeitraum ergab sich, ausgehend von einem Meinungsumschwung in der Medizin, auch für zwangssterilisierte Sinti:ze und Rom:nja ein Durchbruch zu mehr Gerechtigkeit. Erst jetzt erkannte man psychische Krankheiten als typische Spätfolge von NS-Verfolgung und entdeckte ihr Beeinträchtigungspotenzial auf die Erwerbsfähigkeit von Patient:innen, sodass die meisten der zwangssterilisierten Sinti:ze und Rom:nja Ende der 1960er-Jahre zu ihrem späten Recht kamen.
„Vergessene Verfolgte“: Härtefonds und Entschädigung für Zwangsarbeit
Der Anfang der 1980er-Jahre einsetzende Diskurs um die sogenannten „vergessenen Opfer“ sorgte noch einmal für neue Dynamiken. Zu Beginn einer vierten Phase der Wiedergutmachungsentwicklung gelang es NS-Opfergruppen, denen bisher die Zuordnung unter die Kategorien der „rassisch“, politisch, religiös oder weltanschaulich Verfolgten verweigert oder streitig gemacht worden war, ihre prekäre Stellung in der Entschädigungspraxis öffentlich zu skandalisieren. Als Folge dieser öffentlichen Debatten wurden diverse Härtefonds geschaffen, die Einmalzahlungen an NS-Verfolgte ermöglichten, die bis dahin durch alle Raster gefallen waren: 1980 für jüdische Verfolgte, im Dezember desselben Jahres für Zwangssterilisierte und am 26. August 1981 für nicht jüdische Verfolgte.
Die letztgenannte Regelung sollte vor allem Sinti:ze und Rom:nja zugutekommen. Die Hürden, um an die einmalig ausgezahlten 5 000 DM zu gelangen oder in Ausnahmefällen sogar laufende Beihilfen bewilligt zu bekommen, waren allerdings hoch: Voraussetzend blieb die aus dem BEG bekannte Grundbedingung einer Verfolgung aus „rassischen“, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen. Gleichzeitig durfte bisher keinerlei Entschädigung geleistet worden sein. Aussicht auf die Härtemittel hatte also eigentlich nur, wer bisher aus formellen Gründen abgelehnt worden war. Ein Gesundheitsschaden sowie eine wirtschaftliche Notlage mussten zusätzlich vorliegen. Über die Vergabepraxis existiert noch keine Forschung. Von den Organisationen der Sinti:ze und Rom:nja wurde sie als schikanös angegriffen.14Vgl. Rose, Bürgerrechte für Sinti und Roma, 59–67. Allerdings wurden im gleichen Zeitraum auf Betreiben des 1982 gegründeten Zentralrats Deutscher Sinti und Roma viele BEG-Verfahren auf dem Weg des „Zweitverfahrens“ oder durch sogenannte „Verschlimmerungsanträge“ noch einmal aufgerollt, was in vielen Fällen mit einiger Kulanz zu einem positiven Bescheid führte.
Die letzte größere Wende, die Gründung der „Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)“ im Jahr 2000, muss im engen Zusammenhang mit den weltpolitischen Veränderungen seit 1989/91 gesehen werden. In dieser fünften Phase wurden nun auch ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter:innen, deren Leid bis dahin gar keinen Entschädigungsanspruch begründet hatte, mit pauschalierten Einmalleistungen bedacht. Dabei waren auch Rom:nja aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa antragsberechtigt.
Fazit
Viel hat sich seit den 1980er-Jahren verändert, als der politische Streit zwischen den Verbänden der Sinti:ze und Rom:nja und dem deutschen Staat mit Leidenschaft und harten Bandagen geführt wurde. Grobe Fehler der frühen Wiedergutmachungsgesetzgebung wurden korrigiert, damit zusammenhängende Härten abgemildert und juristische Irrwege aufgegeben. Für sein Urteil von 1956 hat der BGH im Namen seiner Präsidentin Bettina Limperg 2016 den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sogar offiziell um Entschuldigung gebeten. 15Vgl. Bundesgerichtshof und Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Doppeltes Unrecht. Dennoch und trotz des unweigerlich bevorstehenden Todes der letzten Überlebenden des NS-Terrors, ist das Thema politisch zwar in den Hintergrund getreten, die Auseinandersetzungen um ungelöste Details und letzte offene Fragen halten aber, zum Beispiel im Hinblick auf eine Anerkennung der Opfer des „Festsetzungserlasses“, bis heute an.
Vor allem aber für die historische Forschung bleibt das Thema Wiedergutmachung für Sinti:ze und Rom:nja eine wichtige Aufgabe. Durch die verspätete Etablierung der Antiziganismusforschung in der akademischen Landschaft ist unser Bild noch immer lückenhaft. Weder kann die Frage nach dem tatsächlichen Ausmaß der Entschädigung für Sinti:ze und Rom:nja abschließend als geklärt gelten, noch wurde bisher die Wiedergutmachung als behördliche und kulturelle Praxis hinreichend untersucht, sodass manche der am komplexen Verwaltungsverfahren beteiligten Akteur:innen wie Entschädigungsbeamte, Richter:innen, Rechtsanwält:innen, Polizist:innen und Ärzt:innen in ihren Interessenlagen, Denkmustern und Handlungsspielräumen nur schemenhaft vor Augen stehen. Auch als spannungsgeladene Räume der (machtasymmetrischen) Begegnung und Interaktion zwischen diesen mehrheitsgesellschaftlichen Akteur:innen und den antragstellenden Sinti:ze und Rom:nja wurde Wiedergutmachung nur selten betrachtet. Gerade auch deren Perspektiven zu betonen und zu eruieren, wie sich im Spannungsfeld zwischen Genugtuung, Dankbarkeit, Abhilfe, Enttäuschung und „zweiter Verfolgung“ der reale Verlauf der Wiedergutmachung materiell und immateriell auf das konkrete Leben der Verfolgungsopfer auswirkte, sollte Aufgabe zukünftiger Forschungen sein.
Von einem schlüssigen Gesamtbild kann auch deshalb keine Rede sein, weil es an einer Vertiefung des Wissens durch Regionalstudien fehlt, die den Blick für übergreifende Muster und länderspezifische Besonderheiten bei der administrativen Umsetzung der Wiedergutmachungsgesetze schärfen könnten. Es besteht die Hoffnung, dass die genannten Forschungsbedarfe in Zukunft vermehrt angegangen werden, denn der lange hemmend wirkende Faktor der schweren Zugänglichkeit der Quellen wird durch das Projekt „Transformation der Wiedergutmachung“ des Bundesfinanzministeriums aktuell behoben, indem mit dem „Themenportal Wiedergutmachung“ in Zusammenarbeit mit den staatlichen Archiven ein digitaler Ort zur Zentralisierung des gesamten, weltweit verstreuten Dokumentenerbes der Wiedergutmachung geschaffen wird.16Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts, Archivportal-D, https://www.archivportal-d.de/themenportale/wiedergutmachung [Zugriff: 19.01.2024].